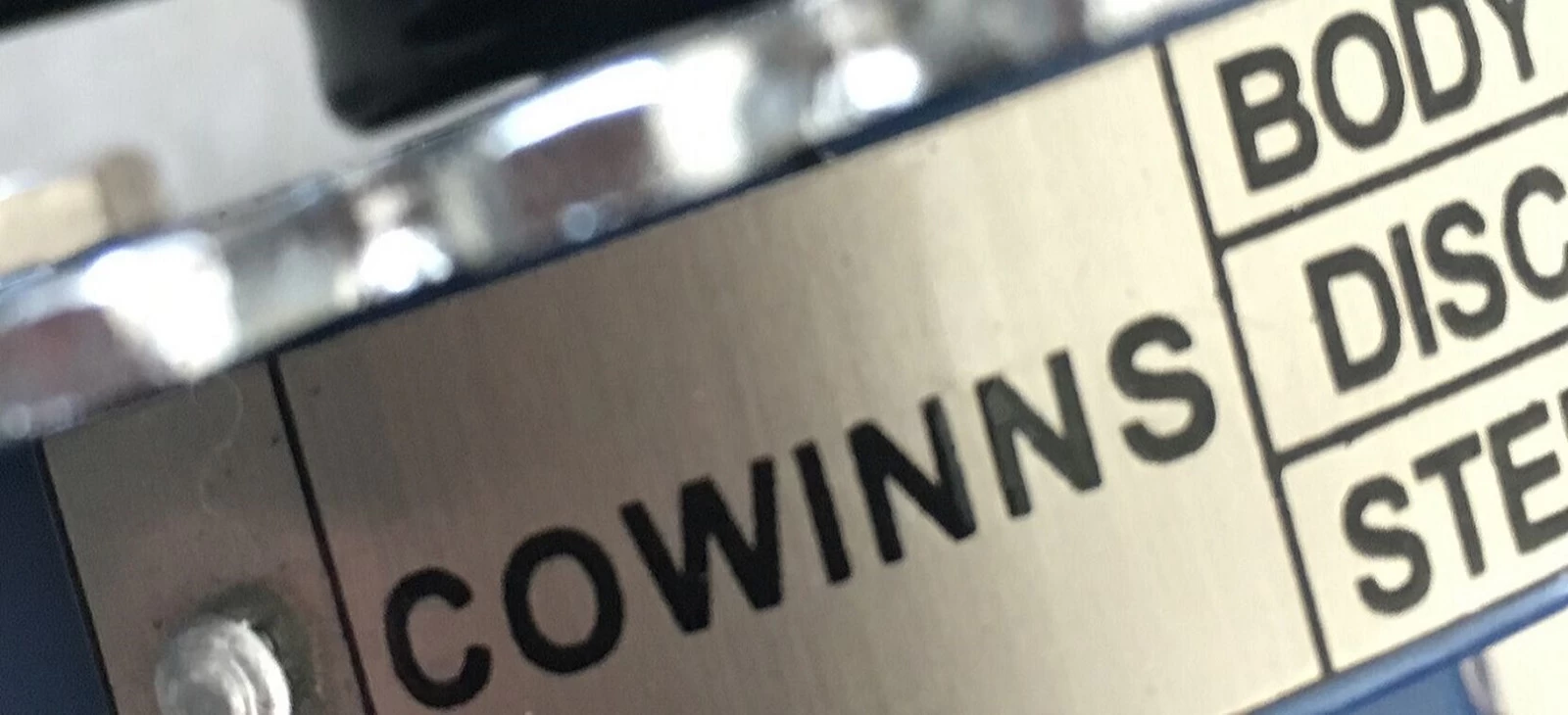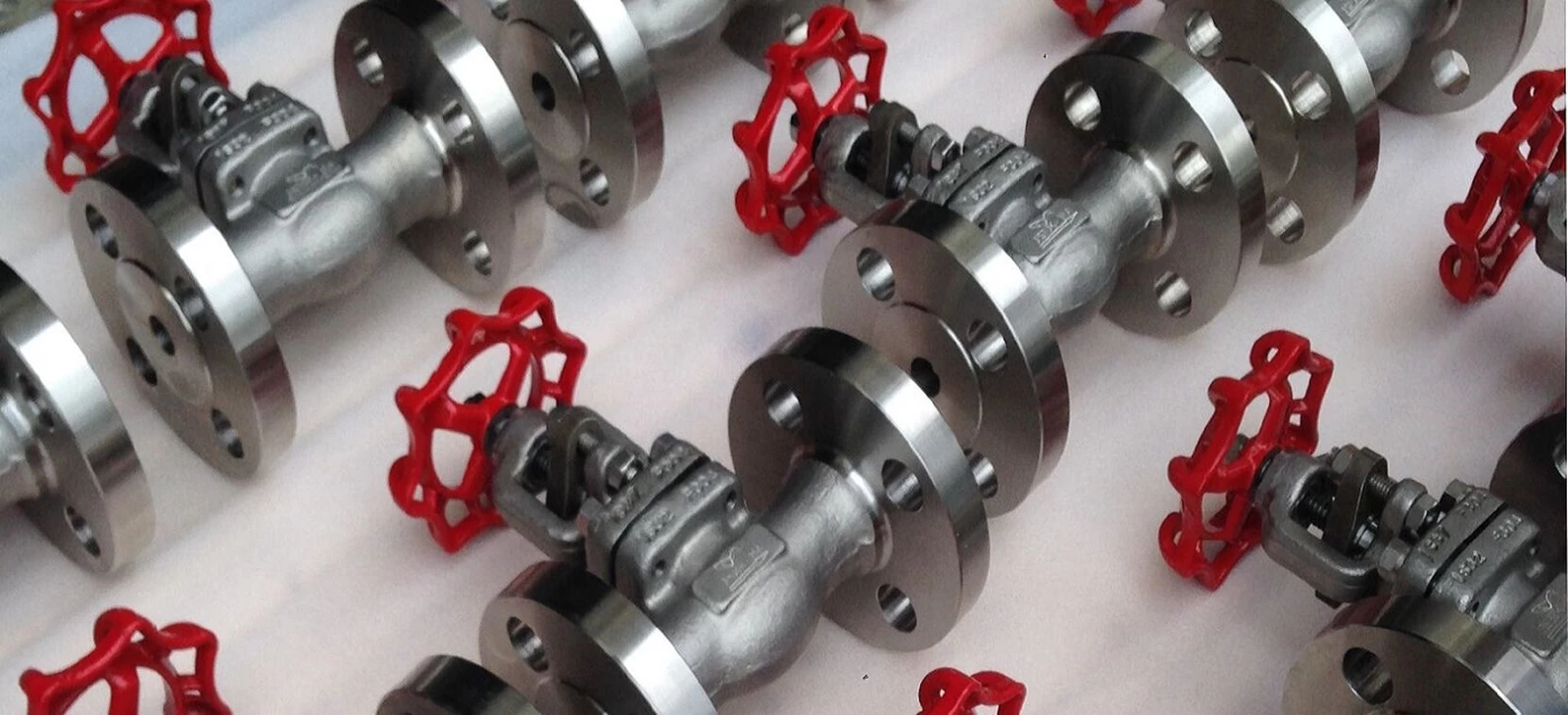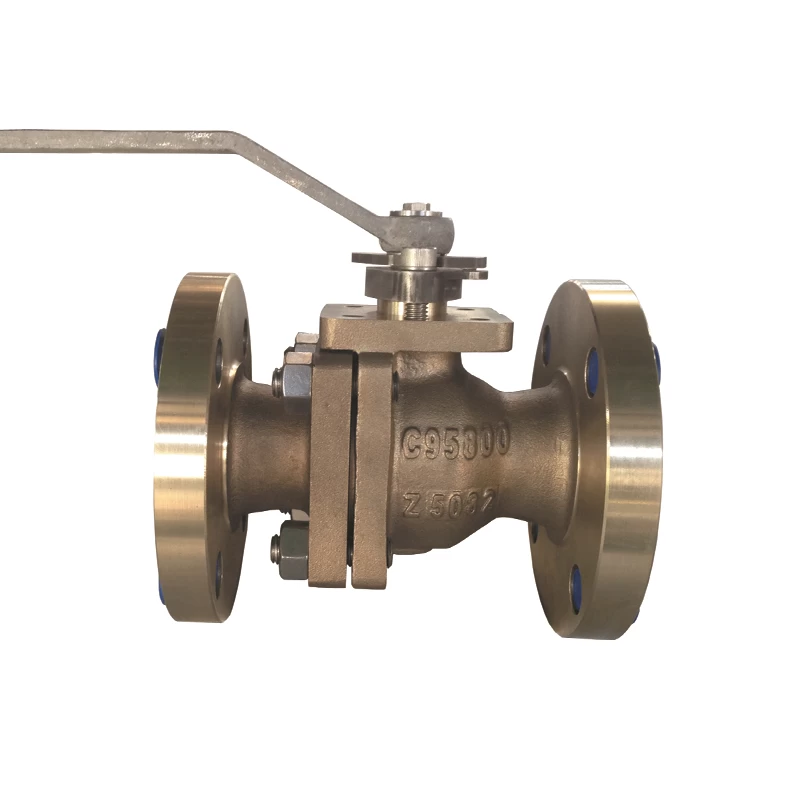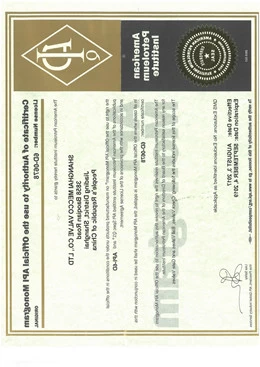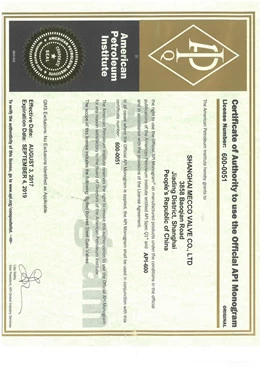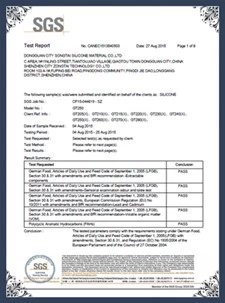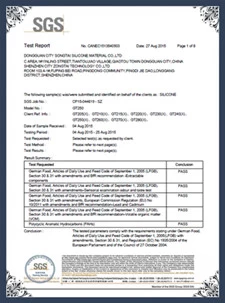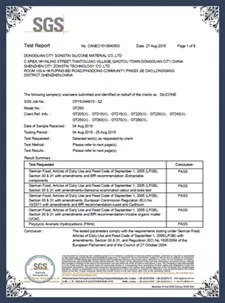Erklärung der Kesselterminologie (Teil 5)
Erklärung der Kesselterminologie (Teil 5)
41. Carnot-Zyklus: Der Carnot-Zyklus ist ein thermodynamischer Zyklus, der zwischen einer Hochtemperatur-Wärmequelle und einem Kühlkörper mit niedriger Temperatur betrieben wird, der aus vier vollständig reversiblen thermodynamischen Prozessen besteht: isothermische Wärmeabsorption, adiabatische Expansion, isothermale Wärmeabnahme und adiabatische Umsetzung. Historisch gesehen repräsentiert es das zweite Gesetz der Thermodynamik. Vorgeschlagen vom französischen Physiker Sadi Carnot im Jahr 1824 ist es ein idealer thermodynamischer Zyklus ohne Energieverlust. Die Prinzipien des Carnot-Zyklus sind auch für hocheffiziente technische Anwendungen relevant, wie beispielsweise die thermische Leistung von Hochdruck hohe Temperaturprüfventile verwendet in kritischen Industriesystemen.
42. Carnot Theorem erklärt:
① Die Effizienz eines Wärmemotors, der zwischen zwei konstanten Temperatur-Wärmebehälter betrieben wird, darf die Effizienz eines Carnot-Motors nicht überschreiten.
② Alle Carnot -Motoren, die zwischen den gleichen beiden Wärmevorratsbehörden arbeiten, haben eine identische Effizienz.
43. Dritter Gesetz der Thermodynamik: Eines der grundlegenden Gesetze der Thermodynamik beschreibt das Verhalten von Wärmephänomenen in der Nähe von Absolut Null. Es wird allgemein angegeben als: Es ist unmöglich, durch eine begrenzte Anzahl von Schritten mit einer beliebigen Methode absolute Null zu erreichen. Im Jahr 1906 schlug der deutsche Chemiker Walter Nernst erstmals den "Wärmesatz" vor, der später von F. E. Simon und anderen in die Nernst-Simon-Formulierung des dritten Gesetzes verfeinert wurde: Da sich die thermodynamische Temperatur annähert, nähert sich die Entropieänderung eines kondensierten Systems in einem reversiblen isothermalen Prozess auch der Entropie.
44. Rankine -Zyklus: Der Grundzyklus von Dampfleistungssystemen, bei dem das Arbeitsfluid Wärmeabsorption, Ausdehnung, Wärmeabstoßung und Kompression in Komponenten wie Kessel, Dampfturbinen, Kondensatoren und Rückzahlungspumpen erfährt. Dieser Zyklus wandelt kontinuierlich die thermische Energie in mechanische Energie um und macht sie für die Stromerzeugung und die industriellen Anwendungen von grundlegender Bedeutung.
45. Wärmeübertragung: Die Untersuchung der Prinzipien für die Übertragung von Wärme. Die Wärmeübertragung ist sowohl in der Natur als auch in der Ingenieurwesen ein häufiges Phänomen. Nach dem zweiten Thermodynamik -Wert fließt Wärme immer spontan von einem höheren Temperaturbereich zu einem niedrigeren Temperaturbereich. Die Wärmeübertragung umfasst drei grundlegende Modi: Leitung, Konvektion und Strahlung.
46. Wärmeleitung: Der Prozess der Wärmeübertragung innerhalb eines Körpers oder zwischen zwei Körpern im direkten Kontakt aufgrund von Temperaturunterschieden, auch als thermische Leitung bezeichnet.
47. Fouriers Gesetz: Das Grundgesetz der Wärmeleitung, ausgedrückt als:
In einem kontinuierlichen, homogenen, isotropen Medium in jedem Moment der Wärmeflussvektor
wobei λ die thermische Leitfähigkeit des Mediums ist und
∇T ist der Temperaturgradient. Das negative Vorzeichen zeigt an, dass der Wärmeflussvektor kollinear ist, aber gegenüber dem Temperaturgradientenvektor, beide senkrecht zur isothermen Oberfläche, wodurch Wärmeflüsse in Richtung abnehmender Temperatur gewährleistet werden. Dieses Gesetz stimmt mit dem zweiten Gesetz der Thermodynamik überein.
48. Wärmeleitfähigkeit λ: Ein Parameter, der die Fähigkeit des Materials misst, Wärme zu leiten. Es bestimmt die Wirksamkeit eines Materials als thermischer Leiter oder Isolator und wird experimentell bestimmt. Im technischen Design ist die thermische Leitfähigkeit ein kritischer Faktor bei der Materialauswahl.
49. Wärmediffusivität α: Eine physikalische Menge, die eine transiente Wärmeleitung beeinflusst, die die Fähigkeit des Materials darstellt, die Temperaturänderungen zu verbreiten. Es ist direkt proportional zur thermischen Leitfähigkeit und umgekehrt proportional zur Wärmespeicherkapazität. Die Materialien mit hohem Thermalableitungsstrom -Erwärmungsverbreitung erleiden die Temperaturdiffusionsdiffussivität. Die thermischen Leitfähigkeitsdifferenzdiffusionsdifferenzieren. Änderung der Temperatur.
50. Es ergibt sich aus den kombinierten Auswirkungen von Wärmeleitung und Flüssigkeitsbewegung, die auch als konvektiver Wärmeaustausch bezeichnet werden.

 86 512 68781993
86 512 68781993