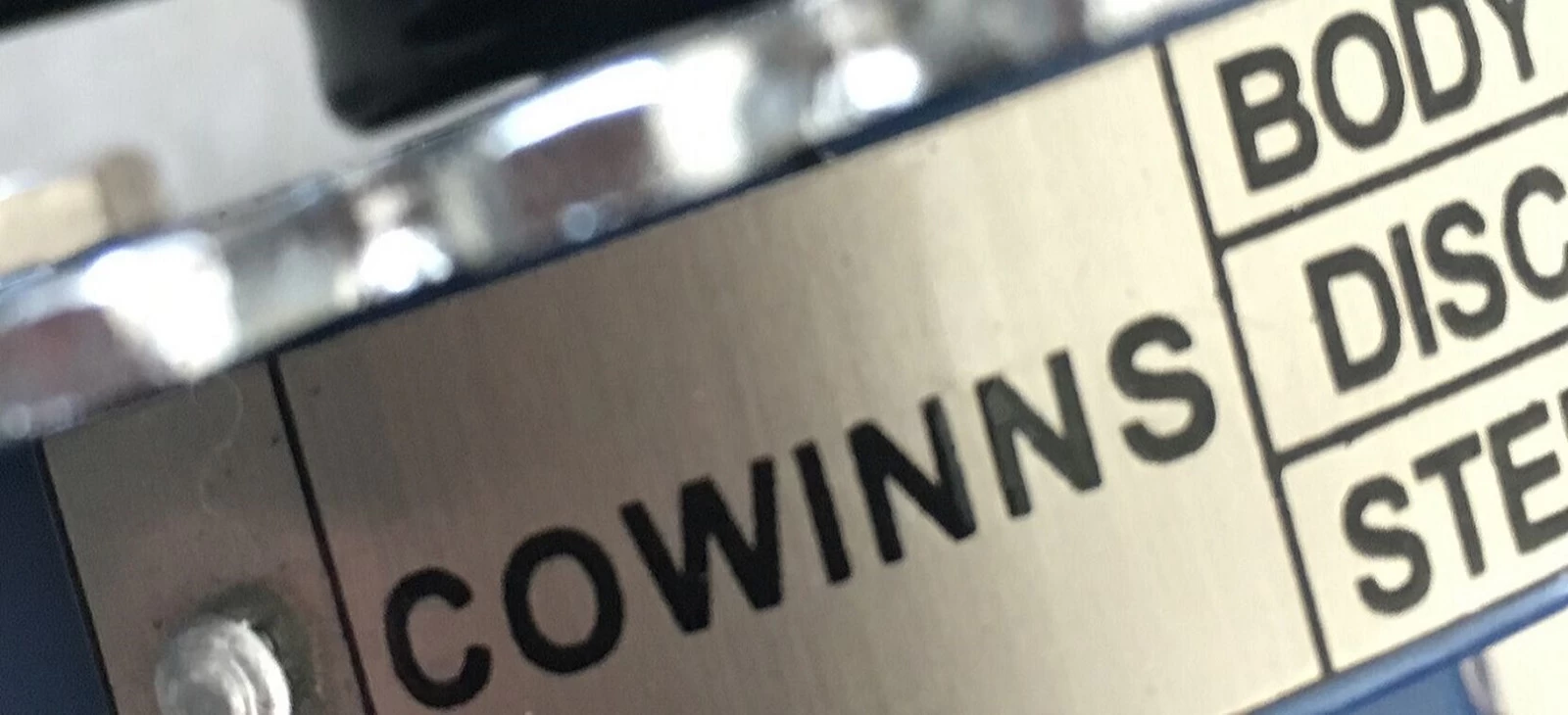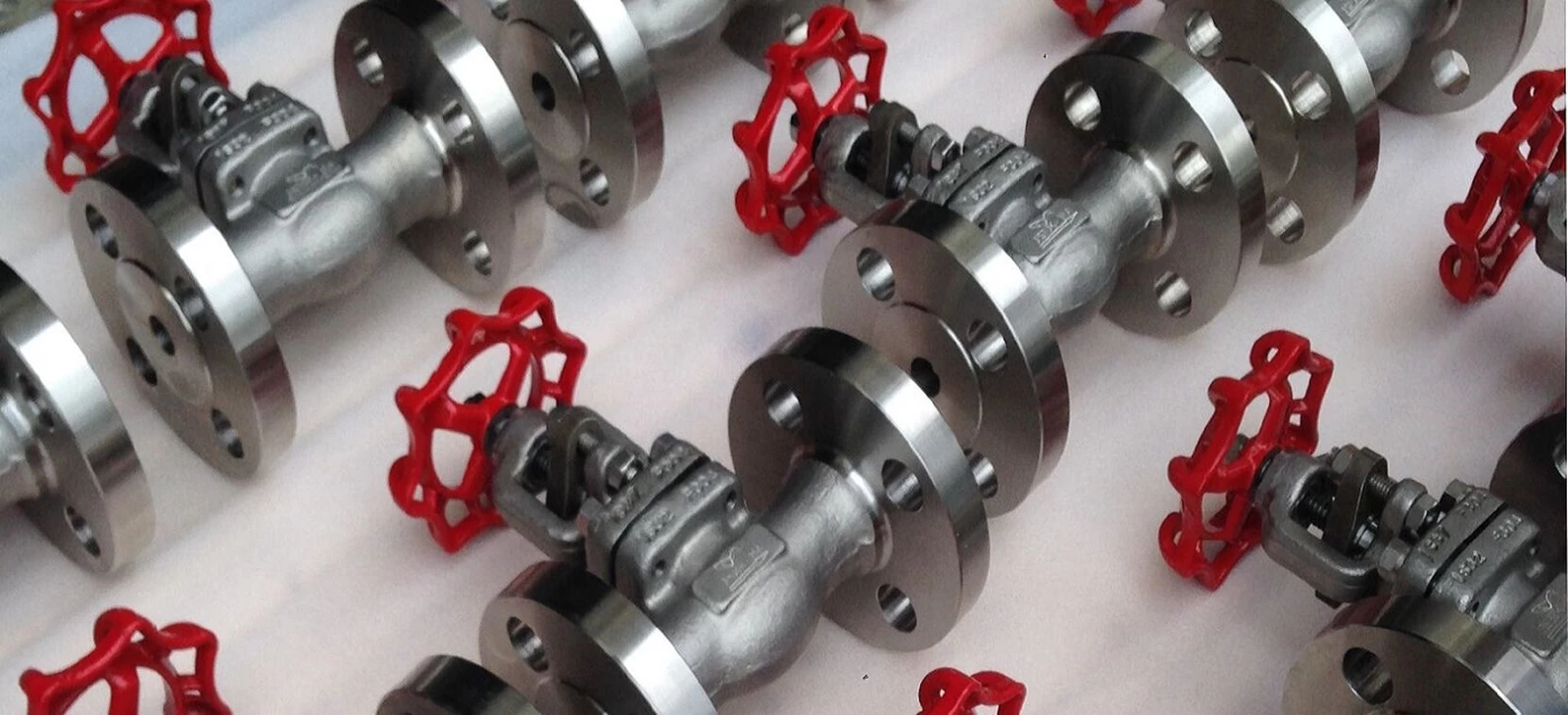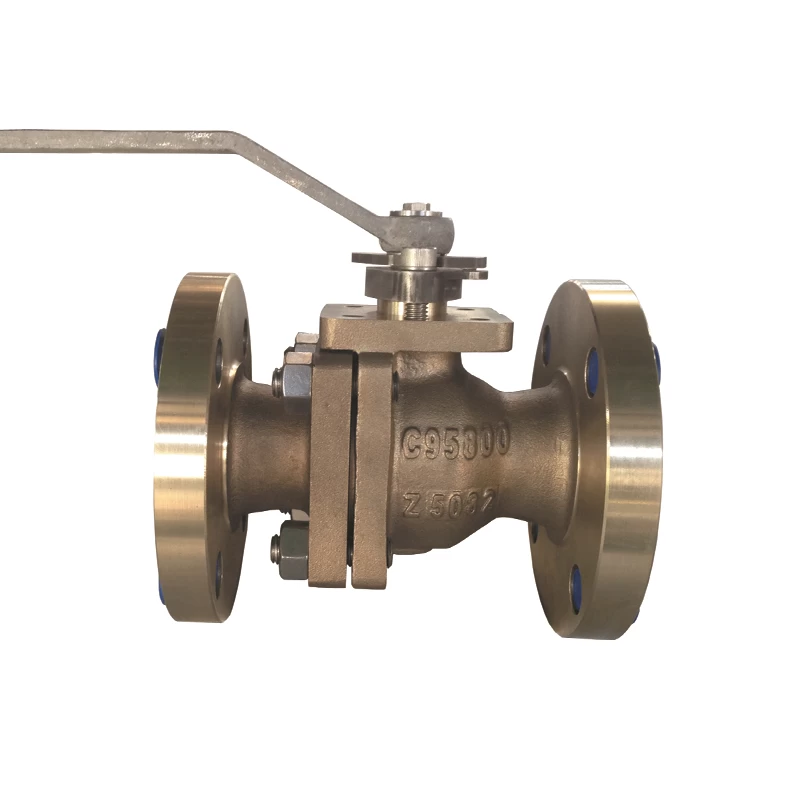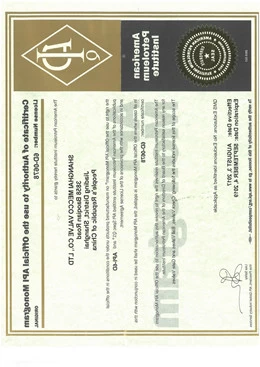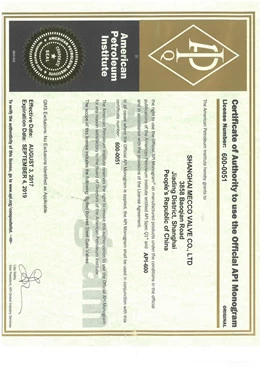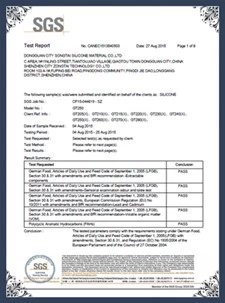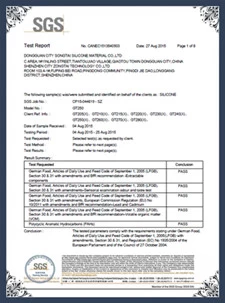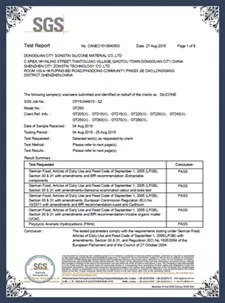Erklärung der Kesselterminologie (Teil 13)
Erklärung der Kesselterminologie (Teil 13)
121. Grindability Index
Der Schleifbarkeitsindex charakterisiert die Leichtigkeit, mit der Kohle pulverisiert werden kann. Seine Messung basiert auf den Neigungsgesetzen, die feststellen, dass die im Mahlen von Kohle verbrauchte Energie proportional zur neu erzeugten Oberfläche ist. Derzeit sind die am häufigsten verwendeten Methoden die Hardgrove-Methode und die Methode des All-Union Thermal Engineering Institute. In industriellen Anwendungen, wie z. B. solche, die Hochdruckdampfsysteme betreffen Druckdichtungspalle ist entscheidend, um Sicherheit und Effizienz in Kohlekraftwerken zu gewährleisten.
122.Abrasion Index
Der Abriebindex repräsentiert den Grad der Verschleißkohle für Metallschleifungskomponenten während des Quetschprozesses. Die Methode YGP (Yancey, Geer und Price) wird üblicherweise verwendet, um den Verschleiß der Kohleprobe unter standardisierten Bedingungen auf reines Eisen zu messen.
123. Coal -Feinheit
Die pulverisierte Kohle besteht aus unregelmäßig geformten Partikeln unterschiedlicher Größen, die typischerweise zwischen 1 und 500 μm liegen. Seine Feinheit wird im Allgemeinen unter Verwendung eines Standardsiebs gemessen, wobei der Prozentsatz der Kohle auf einem Sieb der Maschengröße x (μm) als Rₓ (%) dargestellt wird.
124. Dichte
Die Kohledichte wird typischerweise auf unterschiedliche Weise ausgedrückt, einschließlich der wahren Dichte, der scheinbaren Dichte und der Schüttdichte.
Wahre Dichte: das Verhältnis der Kohlemasse zur Masse eines gleichen Wasservolumens (ohne interne und äußere Porosität) bei 20 ° C.
Scheinbare Dichte: Auch als Pseudo-Dichte bezeichnet, ist es das Verhältnis der Kohlemasse zur Masse eines gleichen Wasservolumens (einschließlich interner und äußerer Porosität) bei 20 ° C.
Schüttdichte: Die scheinbare Dichte der pulverisierten Kohle in ihrem natürlich angesammelten Zustand.
125. Free Swelling Index (FSI)
Der kostenlose Swelling Index charakterisiert die Cabing -Eigenschaft von Kohle. Es wird durch Erhitzen von Kohle unter standardisierten Bedingungen und des Vergleichs der resultierenden Koksklumpen mit einer Reihe von Standard -Koks -Profilbildern bestimmt, um eine Schwellungsindexnummer zuzuweisen.
126. Aschefusionstemperatur (achtern)
Kohleasche hat keinen festen Schmelzpunkt, sondern einen Schmelzbereich. Die weltweit am häufigsten verwendete Methode, einschließlich in China, ist die Kegelmethode, die drei charakteristische Temperaturen bestimmt:
Verformungstemperatur (DT): Die Temperatur, bei der die Spitze des Aschenkegels rund oder biegt.
Erweidungstemperatur (ST): Die Temperatur, bei der sich der Kegel biegt, bis ihre Spitze die Stützplatte oder der Kegel kugelförmig wird und eine Hemisphäre mit einer Höhe nicht größer als der Basislänge bildet.
Fluidtemperatur (FT): Die Temperatur, bei der der Kegel vollständig schmilzt oder sich in einer dünnen Schicht nicht dicker als 1,5 mm ausbreitet und auch als Schmelztemperatur bezeichnet wird.
Einige Länder bestimmen diese charakteristischen Temperaturen anhand eines Hochtemperaturmikroskops, um die Schmelzeigenschaften von säulenförmigen Ascheproben zu beobachten.
127. Ascheviskosität
Ascheviskosität repräsentiert die Flusseigenschaften von geschmolzener Asche bei hohen Temperaturen. Es wird typischerweise mit einem Molybdän -Draht -Torsionsviskosimeter gemessen, wodurch die Schmelzviskosität im Bereich von 1–10 ° C bei Temperaturen unter 1750 ° C ermittelt wird, basierend auf dem Newtonschen Reibungsgesetz.
128. kontrollierter Kreislaufkessel
Ein kontrollierter Zirkulationskessel ist ein Kessel, in dem eine zirkulierende Pumpe zwischen dem Downcomer und dem Riser in der Kreislaufschleife installiert wird, um die Wasserzirkulation zu unterstützen und den Zwangsfluss durchzusetzen. Es wird auch als Hilfskessel bezeichnet. Es enthält drei Typen:
Der kontrollierte Kreislauf -Trommelkessel, entwickelt aus einem natürlichen Kreiskessel mit einem Zirkulationsverhältnis von 2,4–2,5.
Kessel mit niedrigem Verhältnis, entwickelt sich aus einmaligen Kesseln mit Dampfwasserabscheidern mit einem Zirkulationsverhältnis von 1,2–2. Beide Typen stützen sich auf den Dichteunterschied zwischen der Arbeitsfluid im Downcomer und dem Steigrohr sowie dem Pumpenkopf in der Kreislaufschleife, um die Flüssigkeitskreislauf zu ermitteln.
Hybrid-Kreiskessel, der als reiner Durchlaufkessel unter hoher Belastung fungiert und zu einer Kreislaufschwäche mit niedrigem Verhältnis wechselt, wobei die Zirkulationspumpe unter niedrigen Lastbedingungen eingesetzt wird.
129. Zirkulationspumpe
Eine zirkulierende Pumpe ist eine Hochtemperatur-, Hochdruck-, Einstufigenzentrifugalpumpe mit großer Durchflussrate und niedrigem Kopf, das im Dampf-generierenden System eines Kessels zur Durchsetzung des Zwangsflusss installiert ist. Der Elektromotor und der Laufrad der Pumpe sind im selben Gehäuse untergebracht, das in Hochtemperatur und Hochdruckwasser eingetaucht ist. Die Schlüsseltechnologien umfassen den Isolationsschutz des Motors und die Konstruktion der Motorrotorlager.
130. Kesselverdampfsystem
Das Kesselverdampfsystem besteht aus den wärmeabsorbierenden Oberflächen und den Verbindungsleitungen, die das Arbeitsfluid erhitzen, um Dampf zu erzeugen. Basierend auf der Quelle der primären Antriebskraft für die Flüssigkeitsbewegung wird das System in drei Grundtypen eingeteilt:
Natürliche Zirkulation: Verwendet den Dichteunterschied zwischen der Arbeitsfluid im Downcomer und dem Steigrohr, um die Wasserzirkulation zu treiben.
Controlled Circulation: Integriert eine zirkulierende Pumpe zwischen Downcomer und Riser, um die Wasserzirkulation zu unterstützen und den erzwungenen Fluss durchzusetzen.
Einmal durch Fluss: Verwendet den Kopf der Feedwasserpumpe, um einen einzelnen Fluss durch das Verdampfersystem durchzusetzen.

 86 512 68781993
86 512 68781993